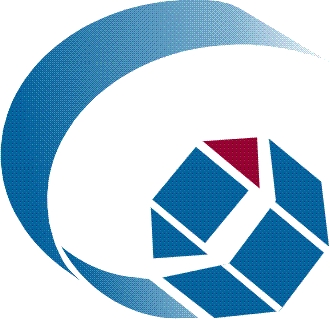 Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau - Roßlau
/ Wittenberg
Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau - Roßlau
/ Wittenberg
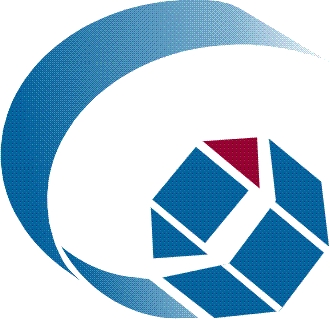
![]()
Das Handwerk zu Zeiten des Dessauer Fürstenhauses
Die Gegend um Dessau war vorwiegend feudalistisch geprägt. Selbst in
Dessau gab es noch eine Vielzahl von Gehöften, die großteils noch
zum Fürstenhof gehörten bzw. ihm zuarbeiteten aber auch der eigenen
Versorgung sowie der Versorgung der immer größer werdenden
Stadtbevölkerung dienten.
Die Fürstentümer der Region im 16. Jahrhundert
 Neben
der Ackernahrung ist als nächster wichtiger Erwerbszweig das Gewerbe
und Handwerk zu bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das
Handwerk sich aus den Nebenbetrieben innerhalb der Gutswirtschaften
entwickelt hat und, dass die ursprünglich unfreien, zu einem
bestimmten Hof (hier der anhaltische Fürsten) gehörenden Handwerker
allmählich zur persönlichen Freiheit und infolge ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung auch zu einer politischen Wichtigkeit
gekommen sind. #2** S. 29 …
Neben
der Ackernahrung ist als nächster wichtiger Erwerbszweig das Gewerbe
und Handwerk zu bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das
Handwerk sich aus den Nebenbetrieben innerhalb der Gutswirtschaften
entwickelt hat und, dass die ursprünglich unfreien, zu einem
bestimmten Hof (hier der anhaltische Fürsten) gehörenden Handwerker
allmählich zur persönlichen Freiheit und infolge ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung auch zu einer politischen Wichtigkeit
gekommen sind. #2** S. 29 …
… Werkstatt auf einem Gutshof
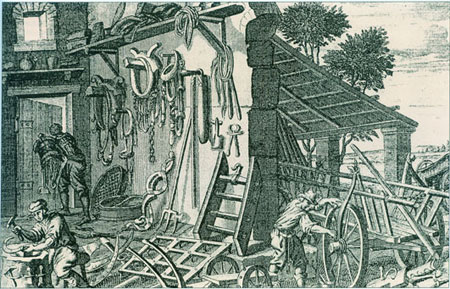 Als
im Mittelalter übliche Form der Handwerker-Genossenschaft haben wir
die Innungen aufzufassen, d.h. den Zusammenschluss der ein
bestimmtes Handwerk ausübenden Meister mit ihren Gesellen und in
gewissem Sinne auch ihrer Lehrlinge. 1371 wurde nach Überlieferungen
die Knochenhauerinnung gegründet. Etwas älter noch dürfte die
Tuchmacherinnung sein, da es ab 1321 in Dessau bereits Tuchwebereien
gab. Die meisten Innungen werden aber erst ab dem 16. Jahrhundert
gegründet bzw. benannt; z.B. Leineweberinnung 1564, Tischlerinnung
1578, Innung der Fischer 1584 und Schwarzfärberinnung 1595.
Als
im Mittelalter übliche Form der Handwerker-Genossenschaft haben wir
die Innungen aufzufassen, d.h. den Zusammenschluss der ein
bestimmtes Handwerk ausübenden Meister mit ihren Gesellen und in
gewissem Sinne auch ihrer Lehrlinge. 1371 wurde nach Überlieferungen
die Knochenhauerinnung gegründet. Etwas älter noch dürfte die
Tuchmacherinnung sein, da es ab 1321 in Dessau bereits Tuchwebereien
gab. Die meisten Innungen werden aber erst ab dem 16. Jahrhundert
gegründet bzw. benannt; z.B. Leineweberinnung 1564, Tischlerinnung
1578, Innung der Fischer 1584 und Schwarzfärberinnung 1595.
Die Innungen hatten, wie auch spätere Genossenschaften, den Zweck, gemeinsamer Vertretung gemeinsamer Interessen, dazu gehörte dann vor allem, dass die Mitglieder derselben überall in Einigkeit und Eintracht wirkten, dass niemand Sonderinteressen vertrat, niemand Gesamtinteressen schädigte, niemand einen Genossen seiner Innung in Ausübung seines Berufes hindernd in den Weg trat.
Diese Eintracht ist symbolisch in machen Bräuchen und Gütern ausgedrückt: „die Zünfte hatten eine Ehre, ein Geheimnis, einen Freudenbecher, eine Bahre (Totenbahre mit Innungszeichen) , aber auch einen Gottesdienst und ein religiöses Interesse. Ihre Sicherung war in den gebotenen Besuchen der alljährlich, meist dreimal abgehaltenen, Morgensprache (wir würden heute Sitzungen dazu sagen) gewährt. Wer ohne ehehaften Grund, „er sei Mann oder Witwe, zwei Jahre die Morgensprache nicht besucht, der soll der Innung gänzlich verlustig sein“ heißt es zum Beispiel in dem Brief der Kramerinnung. …
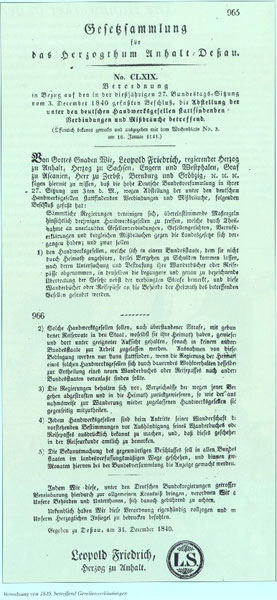 …
Um 1780
…
Um 1780
Auf dem Gebiet des Handwerks finden wir noch die frühere Bevorzugung der Städte. In Dessau wurde noch im Jahr 1781 „Die Satzung der Meister auf dem Lande“ verboten. Nur für einzelne Innungen, die in enger Beziehung zum Bedarf der Landbevölkerung stehen, für Stellmacher, Hofschmiede, Schuster, Schneider, Bäcker und Leineweber, war eine Ausnahme gestattet:
Ihre Bewährung hing aber von der Genehmigung der Regierung ab.
Nach 1784 wurde das Absatzgebiet der Innungen in der Art der alten Bannmeile gesichert. Allmählich gewann die Regierung größeren Einfluss auf das Innungswesen und übte ihn im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit aus. Im Jahre 1764 wurde in Dessau die Verordnung Kaiser Karls VI. vom Jahr 1731 erneut veröffentlicht, ihr entsprechend gewisse Missbräuche abgestellt, wie Erschwerung des Meisterstücks und Abweisung derer, welche die Innung suchten. Solche Abweichung sollte künftig nur mit vorheriger Genehmigung der Regierung gestattet sein. Die wandernden Gesellen erhielten seit 1768 eine gedruckte Kundschaft, zu welcher die Formulare von der Regierung bezogen werden mussten.
Die Regierung griff ferner in das Innungsgeschehen durch Aufstellung von Lohntaxen für die Bauhandwerker ein und erhielt auch zu diesem Verfahren die Zustimmung der Bürgerschaft. Vom Verfall der Innungen zeugen vor allem die sich mehrenden Bitten um Erlassung der gesetzmäßigen Wanderjahre und des Meisterstücks.
In Dessau gab es 1793 folgende Anzahl an Handwerksmeistern:
3 Bader, 8 Barbiere, 34 Bäcker, 6 Beutler, 11 Böttcher, 9 Bordenwirk- und Posamentierer, 4 Buchbinder, 5 Kammmacher, 13 Fleischer, 3 Glaser, 8 Schmiede, 6 Hutmacher, 15 Schlosser, 1 Sporer, 4 Klempner, 5 Knopfmacher, 7 Stadtköche, 5 Korbmacher, 4 Kürschner, 3 Kupferschmiede, 34 Leinweber, 8 Rohgeber, 6 Maurermeister, 5 Nadler, 4 Drechsler, 10 Perückenmacher, 7 Stellmacher, 68 Schneider, 92 Schuhmacher, 9 Seifensieder, 6 Sattler, 5 Strumpfstricker, 8 Strumpfwirker, 34 Tischler, 6 Töpfer, 2 Tuchmacher, 1 Tuchscherer, 3 Weißgerber, 8 Zimmermeister, 4 Zinngießer; #2** S. 128
Die Fürstentümer der Region im 16. Jahrhundert
 Neben
der Ackernahrung ist als nächster wichtiger Erwerbszweig das Gewerbe
und Handwerk zu bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das
Handwerk sich aus den Nebenbetrieben innerhalb der Gutswirtschaften
entwickelt hat und, dass die ursprünglich unfreien, zu einem
bestimmten Hof (hier der anhaltische Fürsten) gehörenden Handwerker
allmählich zur persönlichen Freiheit und infolge ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung auch zu einer politischen Wichtigkeit
gekommen sind. #2** S. 29 …
Neben
der Ackernahrung ist als nächster wichtiger Erwerbszweig das Gewerbe
und Handwerk zu bezeichnen. Es ist allgemein bekannt, dass das
Handwerk sich aus den Nebenbetrieben innerhalb der Gutswirtschaften
entwickelt hat und, dass die ursprünglich unfreien, zu einem
bestimmten Hof (hier der anhaltische Fürsten) gehörenden Handwerker
allmählich zur persönlichen Freiheit und infolge ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung auch zu einer politischen Wichtigkeit
gekommen sind. #2** S. 29 …… Werkstatt auf einem Gutshof
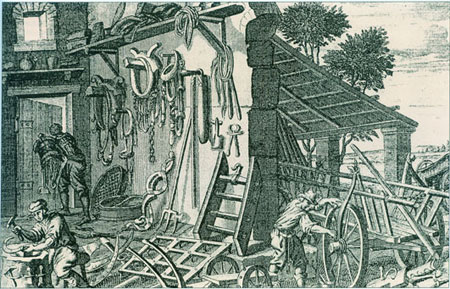 Als
im Mittelalter übliche Form der Handwerker-Genossenschaft haben wir
die Innungen aufzufassen, d.h. den Zusammenschluss der ein
bestimmtes Handwerk ausübenden Meister mit ihren Gesellen und in
gewissem Sinne auch ihrer Lehrlinge. 1371 wurde nach Überlieferungen
die Knochenhauerinnung gegründet. Etwas älter noch dürfte die
Tuchmacherinnung sein, da es ab 1321 in Dessau bereits Tuchwebereien
gab. Die meisten Innungen werden aber erst ab dem 16. Jahrhundert
gegründet bzw. benannt; z.B. Leineweberinnung 1564, Tischlerinnung
1578, Innung der Fischer 1584 und Schwarzfärberinnung 1595.
Als
im Mittelalter übliche Form der Handwerker-Genossenschaft haben wir
die Innungen aufzufassen, d.h. den Zusammenschluss der ein
bestimmtes Handwerk ausübenden Meister mit ihren Gesellen und in
gewissem Sinne auch ihrer Lehrlinge. 1371 wurde nach Überlieferungen
die Knochenhauerinnung gegründet. Etwas älter noch dürfte die
Tuchmacherinnung sein, da es ab 1321 in Dessau bereits Tuchwebereien
gab. Die meisten Innungen werden aber erst ab dem 16. Jahrhundert
gegründet bzw. benannt; z.B. Leineweberinnung 1564, Tischlerinnung
1578, Innung der Fischer 1584 und Schwarzfärberinnung 1595.Die Innungen hatten, wie auch spätere Genossenschaften, den Zweck, gemeinsamer Vertretung gemeinsamer Interessen, dazu gehörte dann vor allem, dass die Mitglieder derselben überall in Einigkeit und Eintracht wirkten, dass niemand Sonderinteressen vertrat, niemand Gesamtinteressen schädigte, niemand einen Genossen seiner Innung in Ausübung seines Berufes hindernd in den Weg trat.
Diese Eintracht ist symbolisch in machen Bräuchen und Gütern ausgedrückt: „die Zünfte hatten eine Ehre, ein Geheimnis, einen Freudenbecher, eine Bahre (Totenbahre mit Innungszeichen) , aber auch einen Gottesdienst und ein religiöses Interesse. Ihre Sicherung war in den gebotenen Besuchen der alljährlich, meist dreimal abgehaltenen, Morgensprache (wir würden heute Sitzungen dazu sagen) gewährt. Wer ohne ehehaften Grund, „er sei Mann oder Witwe, zwei Jahre die Morgensprache nicht besucht, der soll der Innung gänzlich verlustig sein“ heißt es zum Beispiel in dem Brief der Kramerinnung. …
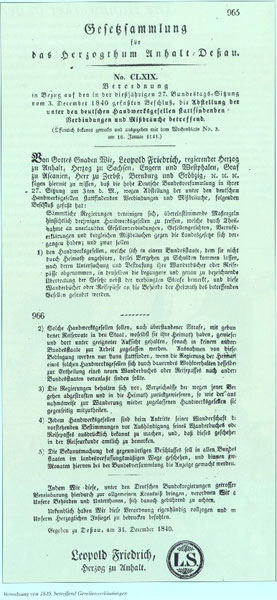 …
Um 1780
…
Um 1780 Auf dem Gebiet des Handwerks finden wir noch die frühere Bevorzugung der Städte. In Dessau wurde noch im Jahr 1781 „Die Satzung der Meister auf dem Lande“ verboten. Nur für einzelne Innungen, die in enger Beziehung zum Bedarf der Landbevölkerung stehen, für Stellmacher, Hofschmiede, Schuster, Schneider, Bäcker und Leineweber, war eine Ausnahme gestattet:
Ihre Bewährung hing aber von der Genehmigung der Regierung ab.
Nach 1784 wurde das Absatzgebiet der Innungen in der Art der alten Bannmeile gesichert. Allmählich gewann die Regierung größeren Einfluss auf das Innungswesen und übte ihn im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit aus. Im Jahre 1764 wurde in Dessau die Verordnung Kaiser Karls VI. vom Jahr 1731 erneut veröffentlicht, ihr entsprechend gewisse Missbräuche abgestellt, wie Erschwerung des Meisterstücks und Abweisung derer, welche die Innung suchten. Solche Abweichung sollte künftig nur mit vorheriger Genehmigung der Regierung gestattet sein. Die wandernden Gesellen erhielten seit 1768 eine gedruckte Kundschaft, zu welcher die Formulare von der Regierung bezogen werden mussten.
Die Regierung griff ferner in das Innungsgeschehen durch Aufstellung von Lohntaxen für die Bauhandwerker ein und erhielt auch zu diesem Verfahren die Zustimmung der Bürgerschaft. Vom Verfall der Innungen zeugen vor allem die sich mehrenden Bitten um Erlassung der gesetzmäßigen Wanderjahre und des Meisterstücks.
In Dessau gab es 1793 folgende Anzahl an Handwerksmeistern:
3 Bader, 8 Barbiere, 34 Bäcker, 6 Beutler, 11 Böttcher, 9 Bordenwirk- und Posamentierer, 4 Buchbinder, 5 Kammmacher, 13 Fleischer, 3 Glaser, 8 Schmiede, 6 Hutmacher, 15 Schlosser, 1 Sporer, 4 Klempner, 5 Knopfmacher, 7 Stadtköche, 5 Korbmacher, 4 Kürschner, 3 Kupferschmiede, 34 Leinweber, 8 Rohgeber, 6 Maurermeister, 5 Nadler, 4 Drechsler, 10 Perückenmacher, 7 Stellmacher, 68 Schneider, 92 Schuhmacher, 9 Seifensieder, 6 Sattler, 5 Strumpfstricker, 8 Strumpfwirker, 34 Tischler, 6 Töpfer, 2 Tuchmacher, 1 Tuchscherer, 3 Weißgerber, 8 Zimmermeister, 4 Zinngießer; #2** S. 128


